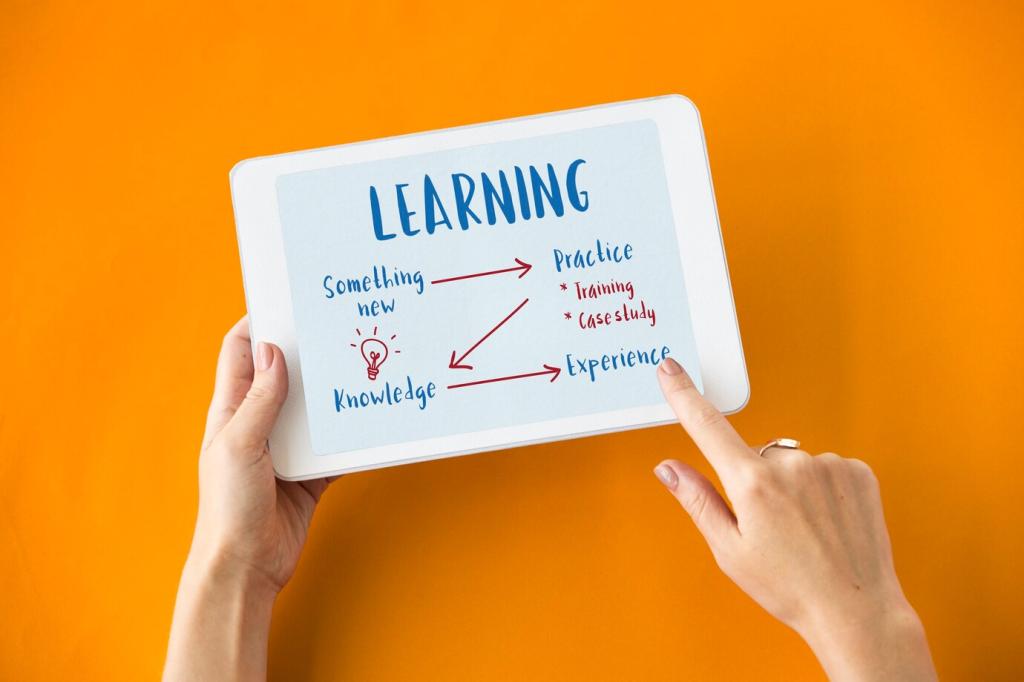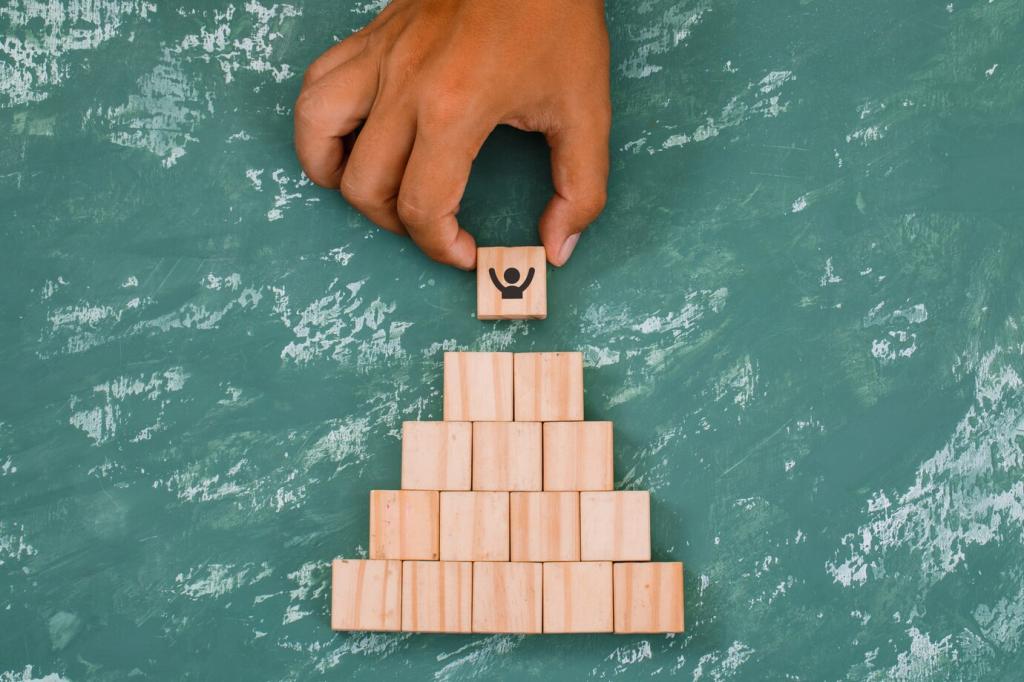Auswahl‑Checkliste für Ihre Plattform
Bewerten Sie UI‑Baukasten, Integrationen, Sicherheit, Governance, Performance und Ökosystem. Prüfen Sie Referenzen in Ihrer Branche. Kommentieren Sie, welche Kriterien in Ihrem Kontext am stärksten gewichtet sind und warum diese Entscheidung letztlich überzeugt hat.
Auswahl‑Checkliste für Ihre Plattform
Wählen Sie einen realen, aber beherrschbaren Prozess. Definieren Sie Erfolgsmessgrößen, Risiken und Migrationsplan. Abonnieren Sie, um eine kostenlose PoC‑Checkliste und praxisnahe Templates für Low‑Code‑ und No‑Code‑Evaluierungen zu erhalten.